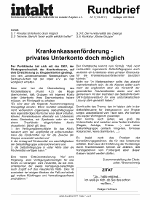|
| |||||
|
Selbsthilfe bei Schüchternheit und sozialer Phobie | |||||
|
Übersicht |
Rundbrief Juni 2011
Zurück zur Rundbrief-Übersicht
 
Krankenkassenförderung - privates Unterkonto doch möglich Der Paritätische hat sich mit der GKV, der Fördergemeinschaft der Krankenkassen, auf eine Erleichterung zu Gruppenkonten geeinigt. Von den Landesverbänden Niedersachsen und Sachsen-Anhalt hat der intakt e.V. es fast wortgleich erhalten. Zwar wird bei der Überarbeitung des Förderleitfadens (Punkt 4.3) die Regel übernommen, daß Gruppen ein eigenes Konto (oder Unterkonto ihres Dachverbands) haben müssen, um Fördergeld zu erhalten. "Es wird aber die folgende Ausnahmeregelung hinzugefügt werden: Wenn rechtlich selbständige, nicht verbandlich organisierte Selbsthilfegruppen kein eigenständiges Konto bei einer Bank erhalten, können Krankenkassen alternativ ein Unterkonto eines Girokontos, ein Sparkonto oder ein von einem Treuhänder eingerichtetes Konto akzeptieren. Dabei gilt, dass 1. ein Verfügungsberechtigter für das Konto benannt wird, der verpflichtet ist sicherzustellen, dass die Fördermittel nur für die Zwecke der Gruppe verwendet werden und 2. der Antrag auf Fördermittel von zwei Mitgliedern der Selbsthilfegruppe unterzeichnet wird und 3. die Selbsthilfegruppe in voller Höhe über die Fördermittel verfügen kann." Eine kleine Entbürokratisierung: "Auf eine Regelung, zwei Verfügungsberechtigte für das Konto zu verlangen, wird verzichtet, da bei Giro-Unterkonten der zweite Verfügungs-berechtigte auch Zugriff auf das Hauptkonto hätte. Dies ist zumindest bei einigen Banken der Fall und würde ggf. weitere Rückfragen und Verwaltungsaufwand produzieren." Der Paritätische kommt zum Schluß, "daß nicht verbandlich organisierte Selbsthilfegruppen auch weiterhin ein Unterkonto eines privaten Girokontos für die Krankenkassenfördermittel benützen können." Nicht nur "in Niedersachsen sollte das absolut unproblematisch sein, da die Kassen selbst auch mehr als unglücklich über die Vorschrift der gesonderten Treuhandkonten waren und sich gemeinsam mit den Vertretern der Selbsthilfe beim GKV-Spitzenverband für eine unbürokratischere Lösung stark gemacht haben." Damit solte das Thema, das im letzten Jahr in der Selbsthilfeszene für Diskussionen und Ängste sorgte, abschließend vom Tisch sein. Wir können uns wieder Wichtigerem zuwenden. Man konnte auch sehen, wie groß die Unterschiede sind zwischen einer festen Institution (Regeln, Anträge, Fristen, ...) und einer Selbsthilfegruppe (einfach hingehen, formlose Absprachen, keine Sanktionen, ...). Es bleibt noch das Problem der Kontoführungsgebühren, die für das Unterkonto anfallen. Doch aus der Einführung der Kontenrege durch Krankenkassen können wir ableiten, daß Kontogebühren vom Fördergeld eben dieser Kassen bezahlt werden dürfen. Zusammenstellung der Zitate: Julian / Braunschweig   
Zumindest einer wollte wirklich helfen ;-) Ich fuhr mit dem Bus von meiner Wohnung zum Bahnhof (etwa 15 Minuten). Neben mir, d.h. auf der anderen Seite des Mittelgangs, saßen zwei Personen, wohl Mutter und Sohn. Er sagte nichts, sie umso mehr. Die bekannte Mischung aus "du bist faul" und "ich will dir doch helfen". Es ging auch irgendwie darum, ihm ein Computerspiel wegzunehmen, und ohnehin um die Schule, in der er Probleme hätte. Da mich das an meine eigene Kindheit in Zeiten des "Schulversagens" erinnerte, stieg in mir der Drang, die eigene alte Schülerwut rauszulassen. Ihr alles an den Kopf zu knallen, was ich meinen Eltern gern gesagt hätte. Doch was hätte das gebracht? 10 Minuten später wären wir ausgestiegen, die beiden wären wieder unter sich gewesen, es hätte keinem etwas gebracht. Aber irgendwas mußte ich doch tun. Ich nahm ein Stück Papier, schrieb die Webadresse des Vereins und des Gruppenkalenders drauf. Nach der üblichen Verzögerung vor Mutaufgaben sprach ich dann den Sohn an: "Entschuldigung, ich hab zugehört. Mir gings in dem Alter genauso. Ich hab dir hier mal aufgeschrieben, gucks dir mal an, vielleicht kommt du in unsere Gruppe. Und da klären wir das ohne Familienkrise." Dann überreichte ich ihm den Zettel, so zusammengefaltet, daß die Mutter ihn nicht lesen konnte. Er sagte danke, kurz danach kam der Bus am Bahnhof an. In meiner Gruppe habe ich den Sohn nicht gesehen. Ich weiß also nicht, was weiter geschehen ist. Doch im günstgen Fall hat er sich die Webseite angesehen, vielleicht sich wiedererkannt, oder neue Ideen bekommen. Hoffentlich baut er sich die Freiheit, das Bestmögliche für seinen Lebensfortschitt zu tun, nutzt seine Eigenmotivation zur Schulkarriere und das Computerspiel sinnvoll zur Entspannung. Aber in einem Punkt ist unwichtig, was sich für ihn geändert hat: Zumindest ich habe meinen Teil der Sache in einer Weise erfüllt, die ich als das Bestmögliche ansehe und mit der ich zufrieden sein kann. Julian / Braunschweig   
Die Funktionalität des Zwangs Er mag zwar übertrieben, aber nicht immer sinnlos sein Einen Zweifel kann man der Zweifelskrankheit gegenüber sicher und getrost ausräumen: Wer glaubt, eine Zwangsstörung sei nicht lästig, belastend oder störend, der wird spätestens bei der Begegnung mit einem Zwangserkrankten im Alltag rasch eines Besseren belehrt. Stundenlanges Händewaschen, dutzendfaches Kontrollieren, penetrantes Ordnen oder unentwegtes Grübeln - nicht nur von außen betrachtet fragt sich jeder an Zwängen Erkrankte oder seine Angehörigen, wie unsinnig die stupide und monoton ablaufenden Handlungen oder Gedankengänge doch sind. Verständlicherweise wollen die meisten Erkrankten daher auch nur eines: die Zwangsstörung soll so bald wie möglich wieder verschwinden. Und unter dem großen Leidensdruck, den Betroffene spüren (und der oftmals einen geregelten Tagesablauf nicht mehr zulässt), haben sie wenig Chancen, über die Hintergründe ihrer Zwangserkrankung nachzudenken - zumindest nicht in den Akutphasen. In diagnostischen Fragebögen wird oftmals erhoben, ob der Zwang vom Betroffenen als übertrieben wahrgenommen wird. Gleichzeitig wird gefragt, ob er ihm als sinnlos vorkommt. Man will wohl an dieser Stelle rückfragen: Ist er nicht "zwangsläufig" sinnlos, wenn er übertrieben ist? Eine provokative These sei in den Raum gestellt: Zwänge haben eine Funktion. Und sie haben auch einen Sinn - wenngleich dieser nicht sofort ersichtlich, und für manch Erkrankten erst spät (oder auch nie) erfassbar wird. Entscheidend ist, dem Zwang trotz all seiner Bösartigkeit mit Neugier zu begegnen. Das schafft man meist nicht im ersten, zweiten oder dritten Jahr der Erkrankung. Eine Zwangsstörung erscheint (wie andere psychische Erkrankungsbilder) wie ein Warnsignal. Der Zwang macht aufmerksam auf Schiefstände im Alltag, die ganz unterschiedlicher Natur sein können. Gerade in den Anfängen des Krankheitsverlaufes besteht die Chance, auf diese Hinweise zu achten und darauf zu reagieren. Tatsächlich ist es jedoch schwer, die Botschaft eines Zwangs auch wirklich verstehen zu können. Alle Psychotherapien haben als wesentlichen Bestandteil die Auseinandersetzung zwischen der eigenen Persönlichkeit und dem Störungsbild des Zwangs. Tiefenpsychologische und psychoanalytische Verfahren legen dabei größeren Wert auf die Erkundung der individuellen Entstehungsgeschichte des Zwangs und der äußerlichen Faktoren, die ihn begünstigen. Gleichzeitig liefert die kognitive Verhaltenstherapie die Basis, aus den Erkenntnissen zu lernen und mit ihnen den Zwang wieder zu ver-lernen. Sowohl Zwangshandlungen als auch -gedanken weisen nicht nur inhaltlich, sondern auch über ihren Ablauf auf änderungswürdige Eigenschaften hin - im persönlichen Alltag oder der Umwelt. Ganz konkret können Zwangsstörungen unter anderem auf folgende Ungleichgewichte hinweisen: Stress: Nicht umsonst wird die Zwangserkrankung in den Belastungsstörungen eingeordnet. Viele Betroffene spüren einen Zusammenhang mit erhöhtem Druck durch z.B. Arbeit, Arbeitslosigkeit, Streitigkeiten, Verlustängste. Gerade in Ruhephasen scheint der Zwang dann den Augenblick zu nutzen, um vermehrt aufzutreten. Die Zwangsstörung ist damit durchaus ein überaus heftiger und ungerechter Anstoß, der aus der Stressfalle aufrütteln will. Sie regt an, sich mit Belastungen und Druck konstruktiv auseinander zu setzen, und durch konsequente Übung die Streßauslöser zu verringern. Freiheitsverlust und Unselbstständigkeit: Viele Betroffene eines Zwangs weisen im Lebenslauf eine große Gemeinsamkeit auf: sie sind über lange Zeit unselbstständig gewesen. Häufig zeigt sich dies schon in der Kindheit, wenn Eltern (in bestem Wissen) eine starke Behütung in den Mittelpunkt ihrer Erziehung stellen. Angst und Sorge um das Wohlergehen des Kindes lassen dessen Eigenverantwortung nur langsam zu. Heraus-forderungen zu meistern, wird nur schleppend erlernt, oder von den Eltern gänzlich übernommen. Das Gefühl, für sich selbst zuständig zu sein, wird möglicherweise unterdrückt und unbewusst als Freiheitsverlust erlebt - der sich bis ins Erwachsenenalter, bis in Studium, Ausbildung oder Beruf fortsetzt. "Auf eigenen Beinen zu stehen": diese Botschaft drückt der Zwang unmissverständlich mit dem Abbild des Gefangenseins in der eigenen Hilflosigkeit aus. Emotionsstarre: Nicht selten wird Zwangserkrankten eine gewisse Gefühllosigkeit nachgesagt. Wenngleich die Betroffenen oftmals unter massiven (aber unnötigen) Schuldzuweisungen leiden, sehr sensibel denken und fühlen, und meist auch in emotionalen Momenten eine große Schwingungs-fähigkeit zeigen - sind sie in der Beschreibung ihres eigenen Lebens oder in der unmittelbaren Anteilnahme eher karg. Geprägt von Stetigkeit und Monotonie ist das "Farbenspektrum der Gefühlsebene" oftmals nur mittelmäßig ausgebildet. Der auftretende Zwang überdeckt weitere Emotionen, wodurch ein Herantasten an die Gefühle erschwert wird. Doch auch hier ist der Sinn eindeutig: Der Zwang macht auf eine undankbare Art Gefühlsdefizite von Betroffenen sichtbar. Ablenkung von inneren Konflikten: Zwangserkrankte entwickeln oft eine eigene Welt aus Schemata und Abläufen. Die Beschäftigung mit Zwangshandlungen und -gedanken (und sei sie noch so ungewollt) zentriert die Aufmerksamkeit auf solche festgelegten Prozesse, was eine Konfrontation mit möglichen inneren Konflikten vermeidet. Nicht aufgearbeitete Erlebnisse oder nicht abgeschlossene Probleme bergen häufig große Anstrengung in sich, sobald sie aufbrechen oder beachtet werden. Zwänge lenken durch ihre Regelhaftigkeit in plagender - aber doch auch schützender - Ausprägung von Themen ab, vor denen wir uns zieren. Wenn man es als Aufgabe beschreiben will, so ist der Zwang dafür zuständig, noch unverheilte Wunden abzudecken - aber auch daran zu erinnern, dass deren Behandlung irgendwann nötig wird. Sicherheitsverlangen: Viele Betroffene bilden mit der Zeit eine Verlässlichkeit auf ihre Zwangsgedanken und -handlungen aus. Die Symptomatik ist fester Bestandteil des Alltags. Betroffene fühlen sich daher oftmals in ihrer gewohnten Umgebung am wohlsten, denn sie haben dort alle wichtigen Bezugspunkte und -personen. Diese gewährleisten nicht nur Sicherheit und Stabilität, sondern begünstigen leider auch die Aufrechterhaltung des Zwangs. Viele Betroffene wünschen sich ausdrücklich das Verlangen nach Kontrolle und das Reduzieren möglicher Überraschungen. Der Zwang führt damit die Einseitigkeit und geringe Flexibilität der Erkrankten vor. Will man überspitzt formulieren, fordert er zu mehr Wagnis und "Trau dich!" auf. Bindungsschwäche: Innerhalb ihrer eingefahrenen Systeme sind Zwangserkrankte durchaus in der Lage zu Bindungen und zwischenmenschlichen Beziehungen. Gerade für Personen, die nicht in die Symptomatik involviert sind, gilt dies im Besonderen. Gleichzeitig sind Betroffene aber auch auf enge Bezugspersonen angewiesen. In der dauernden Spannung zwischen Unabkömmlichkeit von Beziehungen und der mangelnden Ausprägung an beständiger Bindungsfähigkeit, die durch die Handlungen und Gedanken zusätzlich negativ beeinflusst wird, ist dem Erkrankten kaum eine entschlossene Abwägung zwischen Bindung und Abstand zuzumuten. Die häufig Ich-dominierende und narzisstisch geprägte Persönlichkeitsstruktur Zwangserkrankter lässt zudem Beziehungen nur schwerlich in einer notwendigen Gleichberechtigung gedeihen. Die Ausgangslage erweist sich daher für Betroffene als besonders schwierig. Der Zwang ermuntert daher nahezu reizvoll auch zu größerer Gelassenheit, nicht nur im Bezug auf das Wichtig-Nehmen der eigenen Person. Konfliktenthaltung: Zwänge helfen nicht nur, innere Konflikte zu überdecken. Sie dienen auch als Schutzschirm vor weiteren Verletzungen. Zwangserkrankte scheinen nur dann aus der Bahn zu bringen zu sein, wenn Außenstehende in ihre klar geregelten Rhythmen eingreifen. Gerade Angehörige, die sich über die richtige Form des Helfens unsicher sind, gelangen so rasch in Konflikte mit dem Betroffenen - weil sie Grenzen überschritten haben, die lediglich der Erkrankte selbst als für ihn erkennbare definiert. In solchen Momenten scheuen sich auch die Betroffenen nicht vor Konfrontationen. Gleichzeitig lassen die Zwänge die Erkrankten gegenüber Konflikten von außen steril und unnahbar wirken. So ermöglichen die Zwänge auch eine Enthaltung bei Auseinandersetzungen und werden damit ihrem (sicher langfristig in Frage zu stellenden) Schutzfaktor gerecht. Andererseits verhindern die Zwänge damit eine gesunde Dialogbereitschaft und hemmen die Kritikfähigkeit der Betroffenen, die auf geringste Anfeindungen vehementer reagieren als andere oder sich stärker zurückziehen. Zwar wird der Umgang mit den Erkrankten dadurch eher schwieriger - der Zwang fordert aber auch hier Betroffene wie Angehörige zum Trainieren normaler Konfliktfähigkeit auf. Soziale Interaktionssperre: Betroffene von Zwängen kennen das Problem, Zugang zum sozialen Umfeld zu finden, nicht nur durch Scham oder ständige Ausreden. Zwanghafte Persönlichkeitsstrukturen behindern den Umgang mit anderen durch Unsicherheit, Schüchternheit oder die andauernden Handlungen und Gedanken. Der Rückzug in die eigenen Zwangssysteme, aber auch die durch emotionale Verluste eingeschränkte soziale Kompetenz und eine Überempfindlichkeit sind dafür verantwortlich, dass es im Umgang mit Anderen bald zu Missverständnissen kommt. Viele Betroffene reagieren mit einer Art Sperre. Auch hier ist der Zwang Wegweiser: Er setzt darauf, dem Erkrankten größere Nüchternheit für einen entkrampften sozialen Handlungsspielraum "aufzuzwingen". Mangel an Selbstvertrauen: Zwangserkrankungen sind ohne den Zweifel des Betroffenen nicht denkbar. Jedes Waschen oder Kontrollieren würde entfallen, wenn der Erkrankte sich nicht doch wieder fragt, ob jede Bakterie abgetötet oder die Türverriegelung wirklich dicht ist. Der Zweifel an der eigenen Wahrnehmung, an der Selbstkontrolle und am Vertrauen in sich offenbaren auch das (von vielen Betroffenen selbst als niedrig eingeschätzte) Selbstbewusstsein. Die Überzeugung, sich nicht misstrauen zu müssen, geht im Laufe der Zwangsstörung immer mehr verloren. Durch jeden neuen Zwang wird sie weiter gedämpft. Auch wenn die Erkrankung dadurch den Charakter einer zerstören wollenden Macht entwickelt, nutzt sie eine Lücke im Selbstvertrauen aus. Und fordert den Betroffenen auf, sie in der Therapie wieder zu schließen. Perfektionismus, Regeln und Strukturen: Geprägt von perfekt organisierten Strukturen, aber gerade dadurch im Alltag behindert, sind Betroffene von akkuratem Handeln und Denken gezeichnet, welches hin bis zur Penetranz reicht. Abweichungen und Unregelmäßigkeiten in den durchgeplanten Abläufen bringen nicht nur die Ordnung durcheinander, sondern auch neuen Stress und Anspannung bis hin zu erhöhter Emotionalität. Dies zeigt deutlich die Abhängigkeit des Zwangserkrankten von den festen Strukturen. Die Symptomatik unterstreicht diese einerseits, zeigt aber auch die Möglichkeiten auf, aus ihnen auszubrechen. Der Zwang provoziert hier (wie so oft) den Widerstand des Betroffenen, um ihm deutlich seine eingefahrenen Regeln aufzuzeigen - und wie sich eine Befreiung daraus lohnen kann. Entscheidungsentzug: Zwangserkrankte entscheiden selbst über wichtigste Dinge frühestens dann, wenn die Situation nichts Anderes mehr zulässt. Die Fähigkeit, zeitnah und mit Überzeugung zu Entscheidungen zu kommen, liegt einer zwanghaften Persönlichkeit fern. Die Symptomatik lenkt die Konzentration auf Handlungen und Gedanken, aber nicht auf das Wesentliche, nämlich die Entscheidung. Häufig führt diese Entwicklung bis zu schmerzlichen Erfahrungen durch verpasste Chancen. Wer immer und immer wieder seine Entscheidungen aufschiebt, verliert nicht nur den Überblick, sondern auch die Fähigkeit, überhaupt noch klaren Kopfes zu einem Ergebnis zu kommen. Zwangserkrankten sind durch ihre Symptomatik somit deutlich aufgefordert, ihre eigene Entscheidungsfähigkeit zu erhöhen. Bei weitem sind das nicht alle möglichen Funktionalitäten, die eine Zwangsstörung in sich tragen kann. Und doch geben sie eine Tendenz an, sich ihren Bedeutungen zu nähern. Zwänge können damit Ausdruck von verschiedensten Defiziten sein. Damit es zur Ausbildung eines Zwangs kommt, sind selbstverständlich weitere Faktoren notwendig wie z.B. Vererbung von Anlagen zu psychischer Instabilität, bio-chemische Prozessstörungen im Hormonhaushalt, oder Entwicklungsprobleme in der Erziehung oder im sozialen Umgang. Nicht selten können auch traumatische Erlebnisse den Anfang einer Zwangsstörung setzen. Schlussendlich lässt der Zwang den Betroffenen aber eben nicht völlig im Dunkeln. Zwar ist für den Erkrankten die Ohnmacht gegenüber seiner Symptomatik überwiegend. Und dennoch können gerade die strukturellen Muster einer Zwangsstörung darauf hinweisen, an welchen Punkten einer Veränderung ansetzen, und so dem Zwang die eigentliche Existenzgrundlage entziehen kann. Damit bekommt der Zwang - bei allem Unverständnis, welches wir ihm rational entgegen bringen müssen - auch eine Sinnhaftigkeit. Er weist uns direkt und gnadenlos auf Schwächen hin, die es sich zu berücksichtigen lohnt. Selbstverständlich können wir das, was an körperlichen, psychiatrischen oder neurologischen Ursachen zur Zwangserkrankung beiträgt, nicht durch eine Selbstanalyse und das Hören auf die Zeichen des Zwangs in den Griff bekommen. Aber das Ernstnehmen der verschlüsselten Aussagen trägt maßgeblich zu einem anderen Umgang mit dem Störungsbild bei. Und es bietet die Chance, uns selbst zu verändern - an den Stellen, die uns vielleicht nie wirklich bewusst waren. Auch durch eine gewisse Funktion oder Sinn des Zwangs sind wir nicht ermutigt, die Krankheit zu akzeptieren. Doch die Annahme des gegenwärtigen Moments fällt mit einem Blick darauf vielleicht etwas leichter. Zwänge sind damit in mehrfacher Hinsicht herausfordernd: Sie zwingen uns übertriebene Handlungen und Denkweisen auf, von denen wir nicht ablassen können. Sie sind aber zudem eine Aufforderung, über uns selbst nachzudenken. Gleichzeitig ist jeder Zwang ein Schutz. In verschiedenen Lebenssituationen sind wir darauf angewiesen, zunächst Abstand von Belastendem und Unangenehmem zu nehmen. Sich mit sich selbst auseinander zu setzen, birgt neben großen Perspektiven eben auch Risiken. Die Zwangserkrankung fordert daher in besonderem Maße heraus: Werden sie und ihre Symptomatik rechtzeitig erkannt, ist die Hoffnung berechtigt, dass ihre begleitenden Auslösefaktoren zu keiner tiefgreifenden Persönlichkeitsveränderung oder einem langsamen Erlernen von zwanghaften Verhaltensmustern führen. Gleichzeitig ist in jeder Zwangserkrankung, die chronisch zu werden droht, eine sinnhafte Funktionalität zu erkennen - welche es nicht nur ermöglicht, durch intensive Selbstbetrachtung einem Voranschreiten der Gedanken bzw. Handlungen entgegen zu treten. Sondern auch die Signale und Botschaften der Zwänge für eine umfassende Arbeit an den Strukturen des eignen Lebens zu nutzen - was nebenbei auch das erleichternde Gefühl einer größeren Freiheit mit sich bringen kann. Dennis Riehle Selbsthilfegruppenleiter www.dennis-riehle.de stilistisch überarbeitet von Julian Kurzidim   
... 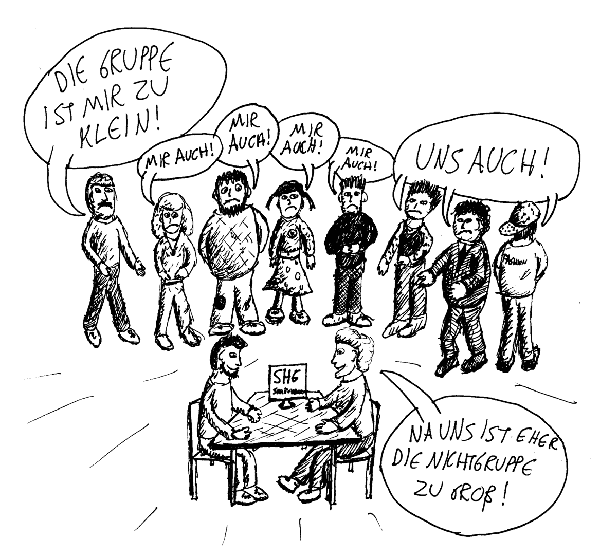
  Zurück zur Rundbrief-Übersicht Zurück zur Rundbrief-Übersicht | ||||
Diese Seite wurde automatisch erstellt mit JULIAN'S MACHSEIT Perlscript
zuletzt am 16.07.2023 um 12 Uhr 26